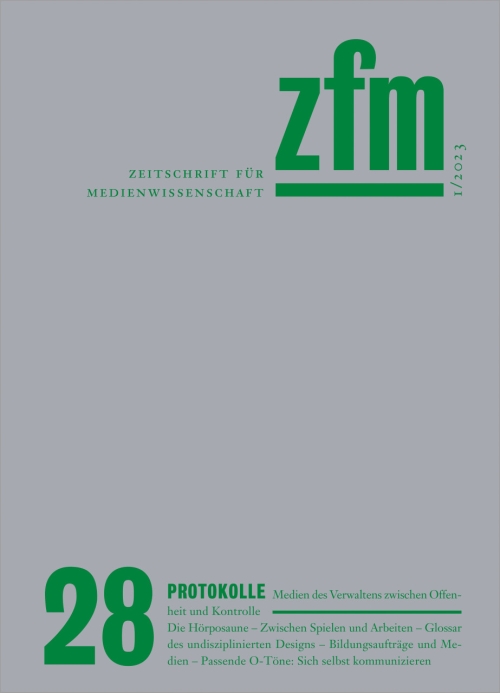Protokolle
Protokolle strukturieren, standardisieren und formieren, was war und was sein wird. Historisch versammelten und validierten sie Dokumente der Verwaltung und des Rechts. Sie formalisieren wissenschaftliche Experimente und sichern ihre Wiederholbarkeit. In Computersystemen organisieren Netzwerkprotokolle adressierbare Objekte, das Klima soll per Protokoll geschützt werden und Diplomatie und Militär setzen protokollarisch auf Fahnen und Musik. Der vorliegende Schwerpunkt erweitert anhand von Aufsätzen und Interviews die Diskussionen über die Logik der Protokolle
Schwerpunkt
- Laura Niebling
Interoperable Protokolle
Der DICOM-Standard und die konfliktträchtige Digitalisierung medizinischer Bilder
- Jan Harms
Von Sprechakten und Schreibfakten
Logiken des Protokolls in den True-Crime-Podcasts «Serial» und «Undisclosed»
- Oliver Leistert
- Mary Shnayien
- Alexander R. Galloway
«Ob man etwas tun kann oder nicht, ist eine rein mechanische oder materielle Frage».
Zu den Politiken und Effekten von Internetprotokollen und den Möglichkeiten ihrer Historisierung
- Oliver Leistert
- Mary Shnayien
- Wendy Hui Kyong Chun
«Das Protokoll ermöglicht eine Bruderschaft»
Zu Offenheit, dem Sozialen und der Dekolonisierung von Protokollen
Bildstrecke
Laborgespräch
- Anja Kaiser
- Maren Haffke
- Jana Mangold
Rutschige Medien
Theoriereflexion, Feminismus und Aktivismus im Grafikdesign
Extra
- Beate Ochsner
- Judith Willkomm
- Harald Waldrich
- Markus Spöhrer
«Serious Gaming» – oder Spielen ernst nehmen
Ein Forschungsprogramm
Debatte
- Andreas Weich
- Adrianna Hlukhovych
Bildungsauftrag
Was Medienwissenschaft im Kontext von Medien und Bildung tut, tun könnte und tun sollte
Werkzeuge
Bevorzugte Zitationsweise:
Gesellschaft für Medienwissenschaft (Hg.): Zeitschrift für Medienwissenschaft. Jg. 15, Heft 28 (1/2023): Protokolle. DOI: https://mediarep.org/handle/doc/20581.