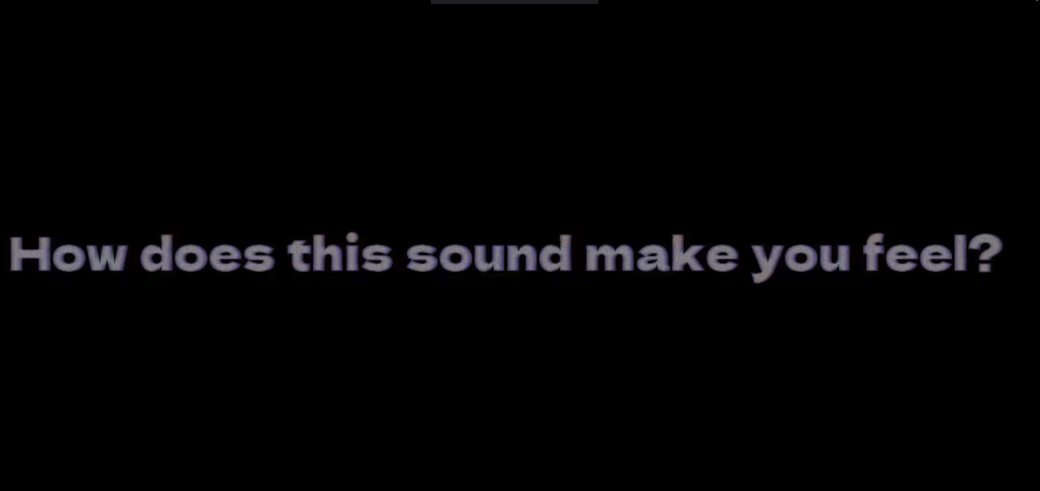
Still aus Sirenscapes (2025), Lee Flamand
Sirenscapes
Der Klangcharakter der Polizei
Sirenen durchdringen zunehmend sowohl urbane Räume als auch unsere Medienlandschaft. Polizeisirenen sind ikonische Merkmale des modernen Stadtbildes und tauchen insbesondere in Hip-Hop-Musik, TV-Krimiserien, Actionfilmen, digitalen Kunstwerken, journalistischen Reportagen und benutzergenerierten Social-Media-Inhalten auf. In manchen Menschen lösen Polizeisirenen Unbehagen aus und signalisieren Gefahr. Andere versprechen sich Sicherheit. Und für viele sind sie allgegenwärtig, ein ganz normaler Aspekt des ‹Soundtracks› ihres sozialen und kulturellen Lebens.
Dieser Videoessay soll die Zuschauer dazu anregen, nicht nur darüber nachzudenken, wo ihnen Sirenen begegnen, sondern auch über die Art und Weise, wie ihre eigene Position/Positionierung ihre Berührung mit und ihre Reaktion auf Sirenen beeinflusst. Er wirft gleichzeitig die Frage auf, wie Sirenen in kommerziellen Medien dargestellt werden und wie diese Darstellungen unterwandert werden können, um kritische Momente zu schaffen. Dieses Projekt wirft eine Reihe von schwierigen methodischen Fragen auf: Wie können die klanglichen Möglichkeiten des Videoessays beim Publikum sowohl emotionales Unbehagen als auch kritische Reflexivität hervorrufen? Welche Herausforderungen ergeben sich, wenn man versucht, nicht nur über die Sirene zu schreiben, sondern mit der Sirene als Medium zu ‹schreiben›? Sirenen stellen für viele Menschen die akustische Signatur staatlich geförderter Gewalt und Unterdrückung dar? Ab welchem Punkt werden die Möglichkeiten der Videokritik zur Belastung?
Dieser Videoessay beantwortet diese Fragen nicht immer explizit, da ich eher zum Nachdenken anregen als definitive Antworten liefern möchte. Der Essay deutet jedoch implizit durch seine stilistischen Entscheidungen auf eine Antwort hin, beispielsweise indem er auf gesprochene Erzählung zugunsten schriftlicher Kommentare vor dem Hintergrund von Audioaufnahmen einer von Sirenen erfüllten städtischen Atmosphäre verzichtet. Ähnliche Ansätze finden sich in der Struktur des Essays, die von soziologischen zu kulturellen Themen übergeht und nicht mit dem Heulen der Sirene, sondern mit/in einer Spoken-Word-Poetry-Performance kulminiert. Es mag unmöglich sein, Sirenen zu hinterfragen, ohne dabei den Umfang ihrer Darstellung zu erweitern, aber es gibt Methoden, sie aus dem oft ignorierten Hintergrund des täglichen Lebens in den Vordergrund unserer kritischen Aufmerksamkeit zu rücken.
Das erste Kapitel (00:26) beschäftigt sich mit der immer stärkeren Verbreitung von Sirenen im städtischen Leben und konzentriert sich dabei insbesondere auf die Entwicklung moderner Sirenen, die nicht nur auditiv mit dem Ohr gehört, sondern auch im gesamten Körper gefühlt werden können. Das zweite Kapitel (03:06) befasst sich mit der ungleichen Verteilung der Polizeipräsenz – und damit der ungleichen Berührung mit Sirenen – entlang von Rassen- und Klassengrenzen in der Geschichte und der heutigen Gesellschaft der USA. Die nächsten Kapitel beschäftigen sich mit der Präsenz von Sirenen in unserer Medienlandschaft. Das dritte Kapitel (05:26) konzentriert sich auf visuelle Medien und untersucht die Verbreitung von Sirenen nicht nur in populären Bildschirmmedien wie Fernsehen, Kino und Videospielen, sondern auch in Kinderbilderbüchern, die alle tendenziell aus der Perspektive der Polizei beleuchtet werden. Der vierte Teil (08:26) ist der Verwendung von Sirenen in der Musik, insbesondere im Hip-Hop, gewidmet. Sie dient als Gegenerzählung zur Polizeiperspektive und verwendet Sirenen, um das Ausmaß staatlich geförderter Polizeigewalt im Leben der schwarzen, sozioökonomisch schwächeren städtischen Bevölkerung hervorzuheben. Populäre Musik kann jedoch aus ihrem Kontext gerissen und mitunter von denselben Institutionen, die sie kritisiert, zweckentfremdet werden. Das letzte Kapitel (11:28) widmet sich zwei Formen kreativer Praxis – einem digitalen Kunstwerk und einem Stück Spoken-Word-Poetry - um zu zeigen, wie künstlerische Praxis Sirenen kritisch betrachten kann. Schließlich lädt eine Coda (14:18) die Zuschauer*innen dazu ein, über ihr Seh- (und Hör-) Erlebnis nachzudenken, einschließlich dem Beitrag des Videoessays zu einer zunehmenden Verbreitung von Sirenen in unserer Medienumgebung, obgleich er diese kritisiert.
Besonderer Dank gilt Ben Kraas, der während seines Praktikums als ‹eTutor› unter meiner Leitung im Wintersemester 2023/24 an der Ruhr-Universität Bochum bei der Erstellung von Screenshots und Audioclips beteiligt war.
Bildquellen
Abb. Still aus Sirenscapes (2025), Lee Flamand
Bevorzugte Zitationsweise
Die Open-Access-Veröffentlichung erfolgt unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0 DE.