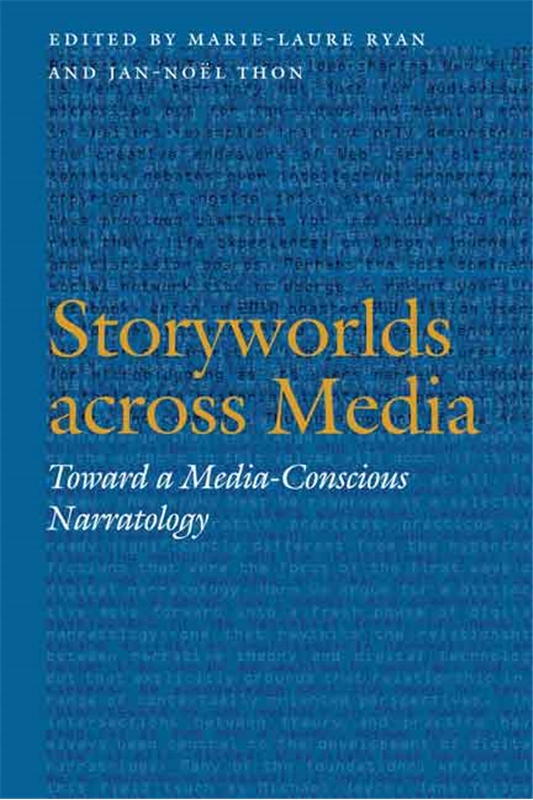Storyworlds across Media
Marie-Laure Ryan, Jan-Noël Thon (Hg.): Storyworlds across Media. Toward a Media-Conscious Narratology, Lincoln, London (Univ. of Nebraska Press) 2014.
Was geschieht, wenn sich Erzählwelten über die Grenzen ihres Ursprungsmediums hinaus entwickeln? Welche analytischen Instrumente müssen neu gestimmt werden, um derartigen Entwicklungen theoretisch gerecht zu werden? Und worin genau liegen die so häufig beschworenen Herausforderungen der sogenannten neuen Medien überhaupt, vor die WissenschaftlerInnen gegenwärtig gestellt werden?
Diese existenziellen Fragen einer postklassischen Erzählforschung und einer narrationsbewussten Medienwissenschaft sind es, die in den 15 Kapiteln des hier besprochenen Sammelbandes Storyworlds Across Media. Toward a Media-Conscious Narratology eine zentrale Rolle spielen. Und dass es sich keineswegs um neue Fragen handelt, die völlig unvermittelt im Zuge eines vermeintlich plötzlich aufkommenden Medienwandels aufgekommen sind, wird durch den Umstand klar, dass die Herausgeber Marie-Laure Ryan und Jan-Noël Thon hier gewissermaßen ein «sequel» (S. 1) vorlegen: Der Vorgänger von Storyworlds across Media, Ryans vielbeachteter Band Narrative Across Media. The Languages of Storytelling, erschien recht genau vor einem Jahrzehnt und kann zu einer frühen Generation von Arbeiten gezählt werden, die sich auf die Übertragung und Anwendbarkeit von erzähltheoretischen Konzepten – welche in der Regel auf literarische Texte zugeschnitten sind – auf verschiedene Medien und ihren Gattungen konzentrieren; also jene Vermittler, die eine Erzählung nicht nur überhaupt erst ermöglichen, sondern auch grundlegend mitbeeinflussen. Durch die Kombination des Medienbegriffs mit der latinisierten Präposition «across» kam dabei dem Phänomen der Transmedialität bereits im Vorgängerband eine Schlüsselbedeutung zu, dessen Untersuchung besonders im Zusammenhang einer «Konvergenzkultur»1 seit einigen Jahren eine besondere Konjunktur erlebt.
Mit der zweiten titelgebenden Schwerpunktsetzung auf den Begriff der «Storyworld» wird im nun vorliegenden Band ein weiteres Konzept in den Fokus gerückt, das derzeit sowohl in der Medienwissenschaft2 diskutiert wird, als auch in den letzten Jahren in der Narratologie3 häufig thematisiert wurde. Dabei stellen diese Welten laut David Herman, der das Konzept in der Erzählforschung maßgeblich geprägt hat, weit mehr als einen bloßen Handlungsort oder das basale narrative Setting dar, in dem sich Figuren und Objekte einer Geschichte versammeln. Vielmehr seien Storyworlds die «mentally and emotionally projected environments in which interpreters are called upon to live out complex blends of cognitive and imaginative response»4 Damit ist das Konzept – ebenso wie die Verwendung des Medienbegriffs selbst – zunächst einmal recht offen und lässt eine große Anschlussfähigkeit unterschiedlicher Ansätze aus verschiedenen Disziplinen zu. Jedoch erweckt gerade die Paarung dieser teilweise sehr uneinheitlich gebrauchten Begriffe schließlich auch den Verdacht, dass das von Ryan und Thon anvisierte Projekt einer «media-conscious narrotolgy» nur allzu leicht in terminologische und theoretische Unschärfe geraten könnte. Wie wird dieses Problem von den Beiträgen im Sammelband aufgegriffen?
Medienbewusste narrotologische Updates in drei Teilen
Neben literatur-, theater-, und filmwissenschaftlichen Perspektiven auf die Bedeutung des Storyworld-Konzepts finden sich im vorliegenden Buch etwa auch Annäherungen aus den Disziplinen der Game- und Fan-Studies. Diese Beiträge, die vor allem auf Vorträgen der gleichnamigen «Storyworlds across Media»-Konferenz aufbauen, welche 2011 im Rahmen des Forschungsschwerpunktes Medienkonvergenz an der Universität Mainz stattfand, sind in drei Teile gegliedert: Im ersten Teil, Mediality and Transmediality, werden ebenso grundlegende wie komplexe narratologische Konzepte wie Erzählerfiguren, Subjektivität und Fiktionalität im transmedialen Kontext behandelt. Im zweiten Teil wird ein Fokus auf Konzepte der Intermedialität und Multimodalität gelegt. Dabei rücken vor allem Fallbeispiele in den Vordergrund, in denen ein Medium bestimmte Merkmale für sich vereinnahmt, um, stark vereinfacht ausgedrückt, formästhetische Merkmale anderer Medien anzunehmen oder verschiedene semiotische Zugänge innerhalb der Grenzen eines Einzelmediums anzubieten.5 Der dritte Teil, Transmedia Storytelling and Transmedial Worlds, widmet sich schließlich einem vielversprechenden Anwendungsbereich des Konzepts der Storyworld: Wurden im Sammelband bis zu diesem Teil etablierte narratologische Begrifflichkeiten und Modelle mit einem ‹medienbewussten Update› versehen, geht es hier um die Analyse größerer narrativer Universen, die sich über verschiedene technische Kanäle erstrecken.
Den Anfang macht dabei Marie-Laure Ryan. Sie unterzieht die Begriffe ‹Medium› und ‹Storyworld›, die ihrer Einschätzung nach häufig als «conviently vague catchphrases» (S. 25) verwendet werden, einer notwendigen Schärfung. Dabei geht sie sehr überzeugend vor, indem sie in einem ersten Schritt mit verschiedenen, teils chaotischen Verwendungen des Medienbegriffs aufräumt und einen dreiteiligen Ansatz vorstellt, der Medien nach einer semiotischen, einer technischen und kulturellen Dimension begreift. Alle diese Dimensionen konfigurieren die Erzählfähigkeit, die Ryan Medien zuspricht, entscheidend mit und dürften bei Analysen nicht außer Acht gelassen werden. Im zweiten Teil des Kapitels beschäftigt sich Ryan mit dem Begriff der Storyworld und ordnet ihm zwei ‹Ahnenlinien› (S. 31) zu: der «possible worlds»-Theorie aus der analytischen Philosophie und kognitiven Ansätzen der Literaturwissenschaften und der Linguistik. Dabei betont die Autorin noch einmal die anfangs erwähnte Vieldeutigkeit des Storyworld-Konzepts und gibt einen Überblick über die sechs Komponenten, die sich in Storyworlds finden lassen: «Existents: the characters of the story and the objects that have special significance for the plot», «Setting», «Physical Laws», «Social Rules», «Events» und schließlich «Mental Events», also die Einstellungen und inneren Vorgänge der Figuren (S. 34–37). Auf diese Ausführungen folgt eine beispielhafte Liste mit theoretischen Anwendungsbereichen, die eine neue Perspektive auf die ‹narrativen Ressourcen› der jeweiligen Medien ermöglichen sollen (S. 37–43) – und welche die LeserInnen für die interdisziplinäre Reichweite der folgenden Beiträge sensibilisiert.
Statt einer thematischen Zuspitzung und Vertiefung einer ganz bestimmten Theorie, welche das Phänomen der «storyworlds across media» entsprechend weiterentwickelt, geht es Ryan also auch um den Blick über den narratologischen und medienwissenschaftlichen Tellerrand in jene anderen Disziplinen, in denen der Medien- und Storyworld-Begriff ebenfalls zunehmend an Relevanz gewonnen hat. Ein solcher Spezialfall wird mit dem zweiten Aufsatz im Band von dem amerikanischen Komparatisten Patrick Colm Hogan geliefert. Hogan untersucht dabei die Repräsentationsstrategien in Shakespeares Hamlet, ein Stück, das eine weitaus größere Storyworld beinhalte, als es der Dramentext allein (oder die jeweilige Aufführungssituation) darzustellen vermag. Dabei konzentriert sich Hogan auf die mimetische Darstellung der Figurenrede, die in der Regel als wesentlich für Theaterstücke angesehen wird, und rückt sie in eine epische Perspektive. Die von historischen Ereignissen und sozialen Konventionen geprägte Welt, in der Hamlet angesiedelt ist, sei demnach durch eine spezifische Selektion einer poetischen Autorität geordnet («selection»), in eine bestimmte Zeitlinie der narrativen Ereignisse gebracht («time») und nach Genreformeln zu einem emotional wirkungsvollen Schauspiel konstruiert («construal») (S. 50–51). Neben der Erwägung eines dramatischen Erzählers, der diese Form der ‹Verplottung› eines Dramas («emplotment») vorantreibt, konzentriert sich Hogan dabei vor allem auf Shakespeares Stilfiguren (in erster Linie Parallelismen und Unterbrechungen, S. 51), die er insgesamt im Lichte einer «discourse manipulation, even in mimetic forms» (S. 64) begreift.
Jan-Noël Thon schließt in seinem Text indirekt an das Thema der figurenbezogenen Darstellungsstrategien von Ereignissen an. Wo Hogan den Storyworld-Ansatz lediglich als Form-Inhalt-Kategorie zur Analyse von Stilfiguren verwendet, dringt Thon noch einen Schritt tiefer in die Materie ein. Dies geschieht sowohl auf theoretischer Ebene als auch auf der Ebene des Materials: Er beschäftigt sich mit der subjektiven Wahrnehmung von Figuren und untersucht, wie sie als transmediale Darstellungsstrategie in verschiedenen Medien funktioniert und schließlich analysierbar gemacht werden kann. Hierzu zieht Thon bei nicht weniger als neun Fallbeispielen (je drei Spielfilme, Graphic Novels und Computerspiele) theoretische Vergleichslinien zwischen objektiven, intersubjektiven und subjektiven Darstellungskonventionen und entwickelt ein transmediales Analysemodell, das vor allem auf filmnarratologischen Studien basiert. Thon unterzieht sein Modell der «four most salient pictorial strategies of subjective representation across media» (S. 72–73) durch die mediale Heterogenität seiner Fallbeispiele einer recht harten Bewährungsprobe; ihm gelingt es jedoch durch die überraschenden bildtheoretischen Korrelationen den Wert einer transmedialen Narratologie zu demonstrieren.
An das Phänomen der Subjektivität in verschiedenen Medien schließen mit Frank Zipfels und Werner Wolfs Beiträgen zur Fiktionalität und Narrativität zwei Texte an, die sich noch einmal substantiellen Problemfeldern der Erzählforschung widmen. Zipfels ausgesprochen pointierter Text konzentriert sich dabei auf die Realisierung des Konzepts der Fiktionalität in Literatur, Theater und Film. Dabei nutzt er Kendall Waltons Buch Mimesis as Make-Believe als Ausgangspunkt und stellt ein transmedial anwendbares Modell vor, das aus drei Komponenten besteht: der Abgrenzung von «Fictional Worlds» zur tatsächlichen Welt, der Involvierung der RezipientInnen in «Games of Make-Believe» und schließlich den Regeln einer «Institutional Practice» (S. 105–109). Auf erfrischend pragmatische Weise betont Zipfel damit nicht nur den imaginativen und spielerischen, sondern auch den durch die narrativ-prädeterminierten Strukturen des Textes regelgeleiteten Aspekt von Fiktionalität, der durch unterschiedliche medienspezifische Konventionen und Affordanzen geprägt ist.
Wolfs «Framing of Narrative in Literature and the Pictorial Arts» stellt schließlich die bei Thon und Zipfel immer wieder durchscheinenden Fragen nach den «triggers of certain expectations» (S. 127) erneut, konzentriert sich allerdings explizit auf die eigentlichen «frames» (S. 126) also die formalen textinhärenten und paratextuellen Markierungen, durch welche eine Zuschreibung von Narrativität bei RezipientInnen angeregt wird. Mit der theoretischen Rasterung fünf verschiedener Arten von frames in der literarischen Gattung der Lyrik und in Werken der Bildenden Kunst, rücken neben inhaltlichen Faktoren vor allem Text- und Bildunterschriften, kontextualisierte Rahmungen, Ausstellungsorte und sequentialisierte Abfolgen in den Fokus. Damit beantwortet Wolf nicht nur die Frage danach, wann RezipientInnen Erzählungen als solche begreifen, sondern schließt auch eine Lücke in Bezug auf die bisher im Sammelband untersuchten medialen Gattungen.
Medien und andere Medien: Multimodalität und Intermedialität
Diese untersuchten Mediengattungen werden im zweiten Teil des Bandes erweitert. Er widmet sich zunächst dem Aufkommen des multimodalen Romans – also literarischen Erzählungen, die Platz für eine Vielzahl unterschiedlicher Darstellungsmodi innerhalb des eigentlichen Texts einräumen. Wolfgang Hallet analysiert dabei Literatur der jüngeren Gegenwart, in der – anders als etwa bei Illustrationen von Kinder- und Jugendbüchern – die ErzählerInnen dem Romantext fotografisches und handgezeichnetes Bildmaterial, Pläne, Tabellen und Karten beifügen, um die LeserInnen in ihrer Welterfahrung zu involvieren. Hallet kommt dabei zu dem Schluss, dass in seiner zentralen Fallstudie (Reif Larsens: The Selected Works of T.S. Spivet) die kartografischen Illustrationen nicht nur ein Leitmotiv des Romans widerspiegeln, sondern dass ihnen darüber hinaus die Funktion eines ‹narrativen Werkzeugs› zukomme. Dabei transformiere sich die tatsächliche Topografie des amerikanischen Kontinents in eine narrative und subjektive Topologie des Protagonisten (S. 160). Es ist schade, dass Hallet an dieser Stelle nicht die Gelegenheit genutzt hat, Ryans zuvor geäußerter Kritik an Kress' und van Leeuwens Multimodalitätskonzept (S. 28) argumentativ entgegenzutreten. Jedoch arbeitet er in seinem Text auf sehr überzeugende Weise die narrativen und ästhetischen Qualitäten und Funktionen der multimodalen Romanform heraus, die eben nicht ‹primär linguistisch geformt› sind (S. 165) und daher die RezipientInnen vor ungewöhnliche Möglichkeiten und Anforderungen stellt, um eine fiktionale Welt zu konstruieren.
Auch Jesper Juuls Beitrag beschäftigt sich mit der mentalen Konstruktion von fiktiven Welten, nimmt jedoch ein völlig anderes – wenngleich auch hochgradig multimodales – Medium ins Visier: das Computerspiel. Dabei untersucht er auch das perzeptuelle Spannungsverhältnis, das zwischen der Imagination des Spielers und dem abstrakten Regelwerk des Spiels entsteht. Die ‹naive Frage› zu Beginn seines Aufsatzes – warum ist es nicht möglich, in einem Kochspiel die Karotten in der Form zu schneiden, wie man sie selbst möchte? (S. 173) – bringt ihn schnell auf seinen eigentlichen Punkt: «video games are half real, meaning that they are an intersection of two quite different things – real rule-based activities that we perform in the actual world and fictional worlds we imagine when playing» (S. 175). Trotz der Fähigkeit des Computerspiels zur Darstellung und Simulation detaillierter Storyworlds durchlaufen SpielerInnen zu Beginn eines neuen Spiels stets einen Prozess der Exploration: Sie probieren aus, welche Möglichkeiten durch die fiktionale Welt des Spiels suggeriert und tatsächlich vom programmierten Regelwerk zugelassen werden. Aus dieser Perspektive werden interessante Aussichten ermöglicht, die gewissermaßen die Ontologie des Spiels und seine Gemeinsamkeiten mit anderen Werken mit fiktiven Elementen berühren. Dazu zählen etwa Genre-, Design-, und schließlich Fragen der Rezeptionsästhetik (S. 189–190).
Jared Gardner widmet sich in seinem Aufsatz dem multimodalen Verhältnis, in welchem die Medien Comics und Film in ihrer bisherigen Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte in enger Weise verbunden waren (Untertitel: «A Multimodal Romance in the Age of Transmedial Convergence», S. 193). Gardner geht es dabei um einen historischen Rückblick der Veröffentlichungsformen und präferierten Lesarten dieser «first two new narrative media of the twentieth century [which] borrowed heavily from each other even as they also explored their own unique affordances» (ebd.). Mit dieser hochinteressanten Prämisse skizziert Gardner die Entwicklung der komplexen «transmedial environments» (S. 194), in welchen diese Medien für ihr Publikum verfügbar waren, kommentiert ihre serielle, stets von Unterbrechungen geprägte Form und stellt heraus, dass sie schon immer offen für eine partizipative Teilhabe des Publikums waren (vgl. S. 194–195). Dabei verzichtet Gardner nur leider gänzlich auf die Nennung konkreter Fallbeispiele, was seine Argumentation insgesamt erheblich stützen würde. Darüber hinaus macht Gardner die Beobachtung, dass sich Spielfilme in den letzten Jahren durch ihre Veröffentlichungsform auf der mit Paratexten und Behind-the-scenes-Material überladenen DVD schließlich einer obsessiven Rezeption von Comiclesern (vgl. S. 203) annäherten. Diese Verbreitungsform fände durch das Aufkommen von Onlinevideotheken und Streamingangeboten gegenwärtig immer weniger Berücksichtigung (vgl. S. 206) – womit Gardner nicht nur ein Licht auf die konventionalisierten Umgangsformen beider Mediengattungen wirft, sondern vor allem auch das Machtverhältnis zwischen der Kulturindustrie Hollywoods und ihrer Zielgruppe.
Nicht die Produktions- und Rezeptionsgeschichte, sondern ganz konkret die intermedialen Wechselverhältnisse zwischen Film und Comic werden schließlich im folgenden Kapitel untersucht. Jeff Thoss argumentiert unter dem Eindruck einer ‹Medienrivalität› (S. 211), inwiefern die Comicserie Scott Pilgrim und seine Filmadaption sich der Formästhetik eines dritten Mediums – des Videospiels – zu Eigen machen. Dabei werden zwar von beiden Medien diverse «intermediale Formzitate»6 ausgestellt; diese werden vom Film jedoch nicht nur adaptiert und schließlich durch die Möglichkeiten der filmischen Darstellungsweise in Form der angesprochenen Medienrivalität übertroffen. Im doppelten Sinne einer Emulation weist Thoss anhand einer sehr genauen wie kenntnisreichen Analyse der in allen Medien verwendeten Stilmittel nach, dass der Film viel eher darauf aus sei, eine selbstbewusste Aussage über seine eigenen Fähigkeiten zu treffen: «it can not only do games better than comics can but also do games better than games do themselves» (S. 222).
Nach dieser deutlich medienwissenschaftlichen Schwerpunktsetzung wird durch Marco Caracciolos Beitrag das Feld der Intermedialität und Multimodalität abschließend wieder aus einer narratologischen Perspektive betrachtet. Thematisch eher an Thons Beitrag anschließend, geht es auch hier um subjektive Repräsentationsstrategien, die jedoch vor allem auf Monika Fluderniks Ansätzen einer natürlichen Narratologie – und in erster Linie dem Konzepts der «experientiality» – aufbauen. «Character’s experiences can be represented only because stories tap into the experiential reservoir shared by the recipients, cueing them into attributing experiences to fictional beings» (S. 231), argumentiert Caracciolo – und erst durch das ‹Anzapfen› dieses ‹Reservoirs› werden die Erfahrungen der fiktiven Figuren schließlich für die RezipientInnen nachvollziehbar gemacht. Caracciolo geht weiterhin Formen eines «consciousness-enactments» (S. 235) nach, die er als einen Pol einer graduellen empirischen Anteilnahme begreift und in den Halluzinations- und Traumsequenzen in William S. Burroughs Roman Naked Lunch und dem Computerspiel Max Payne 2: The Fall of Max Payne vorfindet. Beide Werke stellen nicht nur eine verzerrte Wahrnehmung der ProtagonistInnen («distorted experience», S. 230) durch bestimmte medienspezifische Stilfiguren dar und demonstrieren, wie die LeserInnen und SpielerInnen gewissermaßen im Kopf der ProtagonistInnen eingeschlossen werden (S. 239); Caracciolo weist außerdem nach, wie Roman und Spiel schließlich bestimmte Leitmotive ausstellen, die erst durch ihre selbstreflexive Medienbezüglichkeit zu Tage treten (soziale Kontrolle im Roman durch Sprache, erzwungene Linearität vs. Handlungsträgerschaft im Computerspiel, vgl. S. 245–246).
Transmediales Erzählen, transmediale Welten und die Rolle des Publikums
«Few storytelling forms can match serial television for narrative breadth and vastness. A single narrative universe can continue for years […], with cumulative plotlines and character backstories accruing far beyond what any dedicated fan could reasonably remember.» (S. 253) Der amerikanische Fernsehforscher Jason Mittell gibt mit dieser Zuschreibung den folgenden Beiträgen eine Art Motto, die sich alle – bis auf den letzten Text von Van Leavensworth – thematisch um Fernsehserien drehen, welche narrative Zusatzangebote in transmedialer Form um sich herum organisieren. Mittells Aufsatz ist von diesen Texten dabei mit Sicherheit am breitesten aufgestellt: Er gibt nicht nur theoretische Anstöße zur Bedeutung der seriellen Struktur, sondern skizziert außerdem einen historischen Rückblick über transmediale Formate, überführt Henry Jenkins' Konzept des transmedialen Erzählens7 in die ökonomische Realität des TV-Diskurses und zeigt in einer Gegenüberstellung zweier transmedialer TV-Formate (den amerikanischen Serien Lost (USA 2004–2010) und Breaking Bad (USA 2008–2013), wie ein Analysemodell zur Beschreibung solcher Serien aussehen könnte. Dabei mögen zwar durchaus Zweifel an der Sinnhaftigkeit der nach physikalischen Prinzipien titulierten Kräfte, die Mittell hier am Werk sieht, aufkommen – dem Erkenntnisgewinn durch Mittells scharfen akademischen Blick auf die amerikanischen Fernsehlandschaft wird dadurch aber keinesfalls Abbruch getan.
Mit Colin B. Harvey kommt anschließend ein Schriftsteller zu Wort, der durch seine eigenen Erfahrungen mit der Arbeit am Doctor Who- (GB 2005–…) und Highlander- (FR, USA 1992–1998) Franchise die im Titel angekündigte «Taxonomy of Transmedia Storytelling (S. 278) mit Einblicken aus seinem eigenen Tagesgeschäft aufwertet. Hierbei rückt Mittells Vorüberlegung zum ökonomischen Lizenzgeschäft noch einmal stark in den Vordergrund und wird um juristische Aspekten ergänzt: Die von Harvey aufgestellten sechs transmedialen Kategorien betreffen schließlich keineswegs erzähltheoretische Kategorien, sondern allesamt den Grad an künstlerischer Freiheit, mit dem sich AutorInnen aus dem Fundus des urheberrechtlich geschützten Quellmaterials einer narrativen Marke bedienen bzw. bedienen dürfen und dabei an das Erinnerungsvermögen der Zuschauer appellieren (S. 282–283). Interessant ist dabei vor allem, inwiefern die von Produzentenseite in die Wege geleiteten Steuerungsmechanismen greifen, um bei RezipientInnen den Eindruck der Kanonizität und Kohärenenz einer Storyworld zu vermitteln (die in allen von Harvey genannten Fallbeispielen alles andere als in sich geschlossen ist).
Lisbeth Klastrup und Susana Tosca, deren gemeinsame Arbeit im Diskurs um transmediale Phänomene vor allem aufgrund ihres «transmedial worlds»-Modells8 einen sehr hohen Einfluss genießt, stellen mit der hier behandelten Fallstudie um das TV-Serienphänomen Game of Thrones nun eine Erweiterung ihres Modells in Aussicht (S. 295). Ursprünglich für Online-Multiplayer-Rollenspiele bzw. ‹cyberworlds› entwickelt, liegt der Vorteil des Modells vor allem in der Möglichkeit, eine systematische Vergleichbarkeit von verschiedenen inhaltlichen Elementen zwischen transmedialer Extension und einem Maßstäbe setzenden Original herzustellen. Eine Vertiefung ihres Ansatzes findet jedoch leider nur am Rande statt; tatsächlich bemühen sich die ForscherInnen eher darum, ein vollkommen anders geartetes transmediales Produkt mit einem innovativen Methodenmix in den Griff zu bekommen: die Marketingkampagne, welche vor dem Start der Serie für Werbezwecke in Auftrag gegeben wurde und vor allem aus diversen analogen und digitalen Minispielen besteht. Dabei gehen sie als einzige ForscherInnen im Band qualitativ-empirisch vor, indem sie Interviews und Fragebögen zur Akzeptanz und Wirkung der Kampagne auswerten und in einem zweiten Schritt vor allem auf die Implikationen der Praktiken des ‹social sharing› und der damit verbundenen potentiellen Kompromittierung ihres sozialen Kapitals ins Visier nehmen.
Fanaktivitäten im engeren Sinne sind auch das Thema von Maria Lindgren Leavenworth, die sich vor allem dem Thema der Fan-Fiction zur Roman- und Fernsehserie The Vampire Diaries widmet. Hatte Harvey in seinem Beitrag noch das eng geknüpfte Netz aus autorisiertem geistigen Eigentum, juristischen Einschränkungen und kreativer Autorschaft beschrieben, scheinen die Aktivitäten, die Lindgren Leavenworth hier untersucht, sämtliche urheberrechtlichen Hierarchien zu unterlaufen und mitunter sogar produktiv auszuhebeln (S. 315). Fan Fiction, also Kurzgeschichten, in denen Hobbyautoren bestimmte Erzählstränge des lizensierten Texts neu schreiben, fortführen oder sie mit alternativen Fokalisierungen und unterschiedlichen Ausgängen umdichten, sollten dabei nach Lindgren Leavenworth von akademischer Seite aus als eine, wenn auch nicht als kohärente, Storyworld verstanden und zumindest gleichwertig zum Original behandelt werden. Diese ‹archontischen Texte› (S. 319), die schließlich zu einem größeren Archiv um das kanonisierte Material auswachsen (S. 232), vermögen damit auch einen Resonanzboden zu bilden, auf dem etwa heteronormative Tendenzen, Genderklischees und binäre Oppositionspaare wie ‹Gut und Böse› des Originals artikuliert und umgekehrt werden können (S. 326–327).
Der Sammelband wird schließlich von einem Text von Van Leavenworth zum Abschluss gebracht. Auch hier geht es um eine Storyworld, die gänzlich ohne die Einwilligung ihres ursprünglichen Urhebers in immer wieder neue mediale Sphären ausgebreitet und weiterentwickelt wird: der Storyworld des 1932 verstorbenen amerikanischen Gothic-Schriftstellers H.P. Lovecraft. Das Schaffen eines Autoren synonym mit ‹seiner Welt› zu fassen, mag dabei zunächst nicht im Sinne der bisher behandelten Storyworlds sein (hierzu auch Ryan, S. 32); allerdings arbeitet Leavenworth überzeugend die wiederkehrenden Schemata, Stilistika und Leitmotive heraus, die von Autoren häufig als wesenhaft für Lovecrafts Gesamtwerk identifiziert werden (etwa das Motiv der «cosmic fear», S. 335). Im Sinne eines impliziten Regelwerks und unter Einbeziehung einer intertextuellen, fragmentarischen Verweisstruktur, die den LeserInnen bereits bei Lovecrafts eigentlichen Kurzgeschichten Anreize für eine Jagd nach Hintergrundwissen (vgl. S. 324) gegeben haben, werden – wie auch in Maria Lindgren Leavenworths Beispiel der Vampire Diaries – somit unautorisierte Fortsetzungen und Abzweigungen hervorgebracht, die jedoch nicht nur in der medialen Sphäre des geschriebenen Textes verbleiben, sondern tatsächlich eine medienübergreifende, also transmediale Form annehmen. Leavenworth zeigt hier auf beeindruckende Weise, wie anhand eines von Fans im Stile des Kinos der 1920er Jahre produzierten Stummfilms, eines Brettspiels und einer interactive fiction bzw. eines textadventures auf, wie die jeweilige «thematic media specifity» (S. 338) dabei originelle Stilblüten hervorbringt, die eben nicht ausschließlich narrative, sondern auch spielerisch-ergodische Züge annimmt.
Fazit
Wie aus der Einleitung und der Zusammenfassung der Beiträge deutlich geworden sein sollte, ist der vorliegende Sammelband ganz im Sinne der Herausgeber keineswegs darauf ausgelegt, mit dem Begriff der Storyworld einen weiteren technischen Terminus in eine Disziplin einzubringen, die bereits mit analytischen Werkzeugen weitgehend gesättigt ist. Dennoch stellen alle Beiträge zentrale Überlegungen zur medialen Repräsentation ihrer jeweiligen narrativen Welt an und bilden damit ein Gegengewicht zu einem etablierten geisteswissenschaftlichen Diskurs: Das Konzept der Storyworld sei schließlich auch «a departure from the idea cultivated in New Criticism to Deconstruction that the experience of literature, whether narrative or not, is essentially an experience of language» (Ryan, S. 43). Damit stellt Storyworlds Across Media eine aufgrund ihrer Heterogenität teils herausfordernde, aber ungemein vielfältige Sammlung an Texten dar, welche neue Perspektiven innerhalb jener interdisziplinären Studien eröffnet, die langsam zu einem eigenen Forschungsfeld heranreifen.9 Der vermeintlich hohen Elastizität des Storyworld-Begriffs zum Trotz büßen die meisten hier versammelten Texte daher nichts an analytischer Schärfe ein und liefern einen Überblick über die konstruktiven Ansätze, auf denen sowohl eine interdisziplinäre, in der Tat medienbewusste Erzählforschung als auch eine narrationsbewusste Medienwissenschaft weiter aufbauen kann und durchaus sollte.
- 1Henry Jenkins: Convergence Culture. Where Old and New Media Collide, New York 2006.
- 2Vgl. Mark J.P. Wolf: Building Imaginary Worlds. The Theory and History of Subcreation, New York, London 2013; Michael Saler: What If? Modern Enchantment and the Literary Prehistory of Virtual Reality, Oxford, New York (2012); Derek Johnson: Media Franchising. Creative License and Collaboration in the Culture Industries, New York 2013.
- 3Vgl. Lubomír Doležel: Heterocosmica. Fiction and Possible Worlds, Baltimore 1999; David Herman: Editor's Column. The Scope and Aim of Storyworlds, in: StoryWorlds. A Journal of Narrative Studies, Vol. 1, Nr.1, Lincoln 2009, vii–x; Marie-Laure Ryan: Transmediales Storytelling und Transfiktionalität, in: Karl N. Renner, Dagmar von Hoff, Matthias Krings (Hg.): Medien Erzählen Gesellschaft. Transmediales Erzählen im Zeitalter der Medienkonvergenz, Mainz 2013, 90.
- 4Herman, David: Storyworlds, in: David Herman, Manfred Jahn, Marie-Laure Ryan (Hg.): Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, London 2000, 570.
- 5Zum Begriff der Intermedialität vgl. Irina O. Rajewsky: Intermedialiät, Tübingen 2002. Zum Begriff der Multimodalität vgl. Gunther Kress, Theo van Leeuwen: Multimodal Discourse. The Modes and Media of Contemporary Communication, London 2001.
- 6Zum Begriff des intermedialen Formzitats siehe Andreas Böhn: Einleitung: Formzitat und Intermedialität, in: Andreas Böhn (Hg.): Formzitat und Intermedialität, St. Ingberg 2003, 7–12.
- 7Jenkins: Convergence Culture, 95–134.
- 8Lisbeth Klastrup, Susanna Tosca: Transmedial Worlds. Rethinking Cyberworld Design, datiert 2004, in: www.cs.uu.nl/docs/vakken/vw/literature/04.klastruptosca_transworlds.pdf, gesehen am 14.04.2015.
- 9Vgl. Klastrup, Tosca: Transmedial Worlds, 295.
Bevorzugte Zitationsweise
Die Open-Access-Veröffentlichung erfolgt unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0 DE.