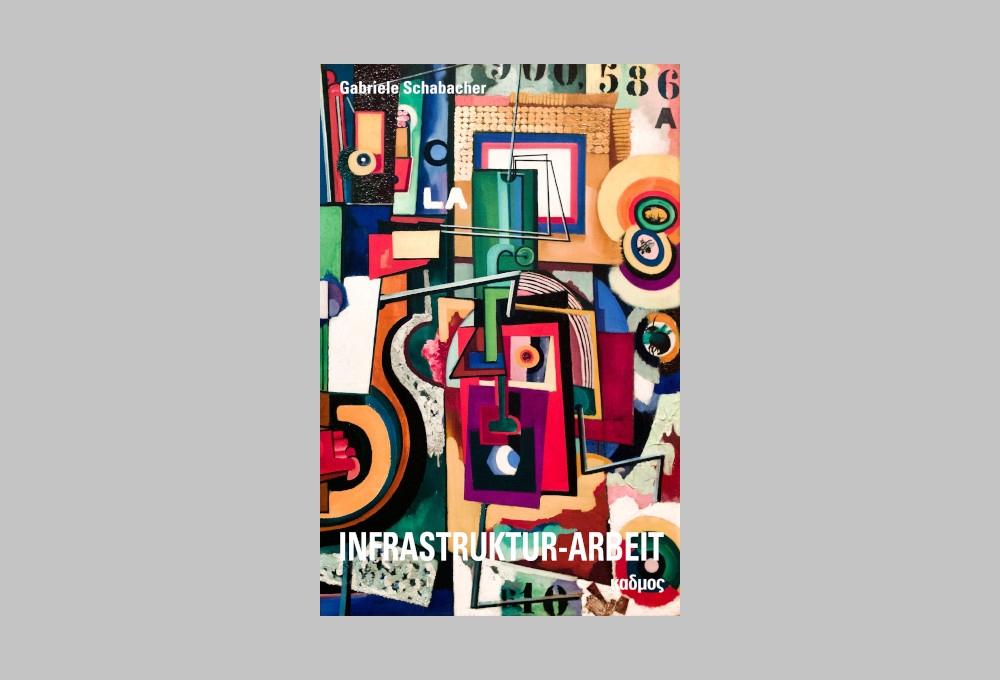Infrastruktur-Arbeit
Kulturtechniken und Zeitlichkeit der Erhaltung
Gabriele Schabacher: Infrastruktur-Arbeit. Kulturtechniken und Zeitlichkeit der Erhaltung, Berlin (Kadmos) 2022
Im Mittelpunkt dieser Studie, die Gabriele Schabacher bereits 2022 vorgelegt hat, steht die Zeitlichkeit von Infrastrukturen. Genauer: Die Autorin befasst sich mit der Frage, inwiefern Kulturtechniken der Reparatur, der Sorge und des Wartens Veränderungen an Infrastrukturen bewirken können. Diese Perspektivierung soll es ermöglichen, die Kultur- und Mediengeschichte der Moderne aus der Sicht von Infrastrukturen lesbar zu machen bzw. aus der Perspektive von Kulturtechniken, die an ihnen vollzogen werden.
Über die Frage nach der Zeitlichkeit gibt Schabacher zu verstehen, dass sie Infrastrukturen als «Medien par excellence» (S. 7) einordnet. So seien die drei medialen Grundfunktionen des Speicherns, Übertragens und des Prozessierens ebenjenen Strukturen in ihrer vermittelnden Operativität inhärent. Sehr anschaulich untermauert Schabacher diese These in den folgenden Kapiteln anhand vieler Beispiele und Fallstudien.
Im ersten Teil von Infrastruktur-Arbeit bietet Schabacher panoramaartig einen Überblick über bestehende Infrastrukturtheorien und Denkweisen, die sich mit dem Themenfeld befassen. Die Autorin identifiziert Infrastrukturen dabei als «grundlegende Mediatoren gesellschaftlich-kultureller Verhältnisse» (S. 27). Auf dieser Grundlage stellt Schabacher einige Zugangsweisen heraus, die für ein medienkulturwissenschaftliches Nachdenken über Infrastrukturen relevant werden können, denen sie im zweiten Teil des Buches nachgeht. So schlägt die Autorin vor, die Medialität von Infrastrukturen anhand von Relationen zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, anhand der Skalierung zwischen global und lokal sowie anhand der schon benannten Zeitlichkeit zu fassen.
Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit erläutert Schabacher unter anderem mit Referenz auf Forschungsarbeiten, die sich in der Umgebung der Akteur-Netzwerk-Theorie verorten lassen. Dazu gehört das Projekt «Paris: Ville invisible», in dem Bruno Latour, Emilie Hermant und Patricia Reed zum Beispiel die Arbeit einer Verwaltungsangestellten der École des Mines dokumentieren. Anhand dieser Dokumentation macht «Paris: Ville invisible» eine Art Oligoptikon (S. 102) sichtbar, das zur Stabilisierung und zur Infrastrukturierung einer Institution benötigt wird.1 Der Skalierung zwischen dem Lokalen und dem Globalen geht Schabacher in Bezug zu Standards und der Metrologie nach.2 Im Hinblick auf die Zeitlichkeit betont Schabacher, dass bestehende Infrastrukturen niemals statisch sind, sondern als Effekt einer immer laufenden Bearbeitung verstanden werden können (vgl. S. 133).
Kapitel drei des Buches stellt heraus, inwiefern Störungen und Unfälle infrastrukturelles Lernen bedingen können. Dieses Lernen kann sich über die Rekonstruktion von Unfällen vollziehen, wie im Falle des 2003 verunglückten Space Shuttle Columbia. Bei solchen Rekonstruktionen gilt es zumeist, ein zeitliches Davor zu rekonstruieren, das sich der Wahrnehmung des Unfalls entzieht. Auch hier spielen also wieder Aspekte von Zeitlichkeit eine Rolle: das Geschehene muss durch eine Art reverse engineering rekonstruiert werden um künftige andere, angepasste, veränderte Konfigurationen zu ermöglichen.
Schabachers Abhandlung ist insgesamt wohltemperiert, konsistent und systematisch einleuchtend aufgezogen und in einer zugänglichen Sprache gehalten. Als besonders stark erweist sich der vierte Abschnitt der Studie, der mit «Kulturtechniken der De/Stabilisierung» überschrieben ist. Über Aspekte des Reparierens, der Workarounds und des Verfalls von Infrastrukturen arbeitet sich Schabacher vor zu einer Herleitung der Anfänge industrieller Wartung. Besonders spannend sind zwei Bewegungen, die Schabacher an dieser Stelle vollzieht. Schabacher denkt über einen Perspektivwechsel nach, der bei dem Blick auf die Welt nicht von stabilen, sondern von ständig im Verfall begriffenen Verhältnissen ausgeht. Bei Steven J. Jackson leiht sie sich in diesem Sinne eine Denkweise des «broken world thinking» und einer «almost falling apart world».3 Dieser Perspektivwechsel zeigt sich als besonders fruchtbar für eine Sichtweise, die sich aus mediengeschichtlicher und kulturtechnikforschender Perspektive mit Infrastrukturen befasst.
Zwar hat auch die Störung, der Unfall demnach wissensgenerierendes Potenzial (vgl. S. 80f.). Durch die Denkweise eines broken world thinking kommt man perspektivisch und analytisch jedoch vor diese Störung. Infrastruktur-Arbeit weist im Grundtenor zudem eindringlich darauf hin, dass Infrastrukturen wichtig sind und dass es bestenfalls nicht erst zu einem Zwischenfall kommen sollte, um daraus zu lernen. Konzeptuell weist eine Perspektivierung des möglichen Zusammenbruchs auf Denkweisen des Blackboxing in der ANT hin. Allerdings regt Schabachers Arbeit an, den Blick von eher begrenzten Settings auf größere, weitreichende Systeme der Daseinsvorsorge auszuweiten.
Gewinnbringend geht die Autorin zudem dezidiert auf die Etymologie des Begriffs des Wartens ein. Das Verb Warten umfasst demnach je temporal unterschiedlich gelagerte Dimensionen. Einerseits bezeichnet der Begriff, dass ein*e Wartende*r das Eintreten einer bestimmten Situation erwartet. Andererseits verweist der Begriff sowohl im Englischen (maintenance, to maintain) als auch im Deutschen auf eine Dimension, die mit der Sorge um sowie der Hinwendung zu etwas bezeichnet ist – eine Dimension, die also in einer bestimmten offenen Gerichtetheit des Vorgangs des Wartens begründet liegt. Affektive und temporale Dimensionen verbinden sich hier zu einer Offenheit der jeweiligen Tätigkeit des Wartens, des Reparierens und in dieser Offenheit ergibt sich somit auch eine Verbindung zwischen den Existenzweisen der je beteiligten Entitäten – zwischen den Wartenden, Reparierenden und Pflegenden und den zu wartenden und reparierenden Dingen und Systemen wie auch den zu pflegenden Menschen (vgl. S. 286f.).
In den Momenten und Situationen, in den Praktiken, anhand derer Wartende sich einer zu wartenden Infrastruktur zuwenden, tritt ein medial-vermittelndes Potenzial hervor. Hier zeigt sich eine Verbindung zwischen einer lokalen Tätigkeit und einer überlokalen Vernetztheit mit und in der Infrastruktur, die trotz ihrer Überlokalität doch immer an einzelnen Punkten lokal bleiben muss. Hier zeigt sich gerade die medienhistorisch-kulturtechnikforschend grundierte Zugangsweise Schabachers als fundierter Einstieg in Überlegungen, wie Infrastrukturen medienkulturwissenschaftlich perspektiviert werden können.
Die konzeptuelle Vorarbeit von Autor*innen wie Susan Leigh Star, Geoffrey Bowker oder James R. Griesemer wurde in der Medienkulturwissenschaft bisher schon beleuchtet und anschlussfähig gemacht.4 Andere Ansätze überlegen, inwiefern wiederum eine praxeologisch orientierte Lesart von Infrastrukturtheorien die Mediengeschichtsschreibung informieren könnte.5 Gerade in der historischen Dimension liegt ein Potenzial, das auch Schabacher stark macht: Jede Aufarbeitung eines Unfalls nimmt sogleich eine historische Perspektive ein, die sich zeitlich rückwärts vor das Ereignis arbeiten muss.
In dieser Erkenntnis befindet sich Schabachers Studie auch in freundlicher Nachbarschaft zu Monika Dommanns Materialfluss. Eine Geschichte der Logistik an den Orten ihres Stillstands. Ganz im Sinne Susan Leigh Stars betont auch Dommann die Überzeitlichkeit von Infrastrukturen und weist damit – wie auch Gabriele Schabacher – auf die Relevanz temporaler Kategorien hin.6 Gerade in der Infrastrukturgeschichte erkennt Dommann einen von mehreren Treibern verschiedener Verschiebungen in ihrem eigenen Fach der Geschichtswissenschaft.7 Mit diesen Verschiebungen gehe, so Dommann, womöglich eine nomadische Epistemologie innerhalb der Geschichtswissenschaft einher, die ihren Fokus auf Relationen richtet, auf Bewegung, auf Hybridisierungen, Transformationen und vieles mehr.8 Auch Dommann legt eine Betonung auf die Störungsanfälligkeit verschiedener Netze, die insbesondere temporal verfasst ist. Sobald Protokolle nicht mehr befolgt und Zeitregime nicht mehr synchronisiert würden drohe der Verfall und die Störung.9 Mit Schabachers vorliegender Arbeit führt der Weg, wie gesagt, vor die Störung.
Wie relevant diese Bewegung sein kann, zeigt nicht zuletzt wie sehr Infrastrukturen in den vergangenen Jahren vermehrt ins öffentliche Bewusstsein treten. Im Osten Europas greift Russland die Ukraine an und zerstört ganz gezielt und im großen Maßstab kritische Infrastrukturen. Pipelines werden sabotiert. Im Kontext hybrider Kriegsführung werden IT-Infrastrukturen angegriffen, Mailprogramme gehackt, Urananreicherungsanlagen lahmgelegt. Kommunen verstehen sich international im Rahmen von Smart City Initiativen als infrastrukturierende Größen und Test-Beds für die Anwendung digitaler Technologien im städtischen Raum. Daten werden zusehends als öffentliche Infrastruktur verstanden, die von ebenjenen Kommunen bereitgestellt wird.10
Infrastrukturen bieten einen nahezu unerschöpflichen Fundus an Forschungsmaterial. Gabriele Schabachers Infrastruktur-Arbeit macht Lust, sich diesem Fundus zuzuwenden. Nicht allein als Forschungsgegenstand, sondern auch als Denkweise, auch darauf weist Schabacher hin, bieten Infrastrukturen ein analytisches Potenzial. Nicht zuletzt ermöglicht eine infrastrukturelle Inversion beispielsweise die Entmystifizierung großer Erfindungen, indem vielmehr ein Fokus auf die rahmenden Kapazitäten von Infrastrukturen geschaut werden kann, die vermeintliche Innovationen erst mit hervorbringen. Alles in allem ermöglicht Schabachers Zugang, der medienhistorisch und kulturtechnisch fundiert ist, eine gewisse Verlangsamung des Tempos. Eine solche Denkweise lässt sich nicht von den Ereignissen überrollen. Sie geht einen Schritt zurück – nicht allein vor die Störung, sondern auch vor die Situation.
- 1
Ein Oligoptikon beschreibt, dass Sichtbarkeiten erst über eine Verbindung aus Praktiken und Assoziationen in Bezug auf eine lokale Fragestellung hergestellt werden. Dabei entstehen z.B. Datensammlungen, auf deren Grundlage Entscheidungen getroffen werden können – in diesem Fall bezüglich der Raumplanung einer Bildungsinstitution.
- 2
Metrologie beschreibt die wissenschaftliche Lehre des Messens und die Entwicklung sowie den Unterhalt von Einheitensystemen. Standards ermöglichen Zugänge zu und die Zusammenarbeit zwischen solchen Systemen, indem sie weitere Standards regeln. Darin zeigt sich bereits die Notwendigkeit der Skalierung: Auch unter lokalen metrologischen Bezugspunkten und Bedingungen ermöglichen Standards das ‹Auslesen› globaler metrologischer Einheiten.
- 3
Steven J. Jackson: Rethinking Repair, in: Tarleton Gillespie, Pablo J. Boczkowski, Kirsten A. Foot (Hg.): Media technologies: Essays on communication, materiality, and society, Cambridge (MA), London, 2014, 221–239, hier 221f.
- 4
So unter anderem in: Sebastian Gießmann, Nadine Taha (Hg.): Susan Leigh Star. Grenzobjekte und Medienforschung, Bielefeld 2017.
- 5
Vgl. Axel Volmar: From Systems to «Infrastructuring»: Infrastructure Theory and Its Impact on Writing the History of Media, in: Aaron Pinnix, Axel Volmar, Fernando Esposito, Nora Binder (Hg.): Rethinking Infrastructure Across the Humanities, Bielefeld 2023, 51–64, hier 52 ff.
- 6
Vgl. Monika Dommann: Materialfluss. Eine Geschichte der Logistik an Orten ihres Stillstands, Frankfurt/M., 2023, 28.
- 7
Vgl. Monika Dommann: Alles fließt: Soll die Geschichte nomadischer werden?, in: Geschichte und Gesellschaft, Jg. 42, Nr. 3, Juli-September 2016, 516–534, hier 516.
- 8
Vgl. ebd.
- 9
Vgl. ebd., 524.
- 10
Hierzu beispielsweise: Friederike von Franqué, Stefan Kaufmann: Daten als öffentliche Infrastruktur. Impulse für den Rechtsanspruch auf Open Data, in: böll.brief – Grüne Ordnungspolitik, Nr. 19, September 2022.
Bevorzugte Zitationsweise
Die Open-Access-Veröffentlichung erfolgt unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0 DE.