Forschungsdaten (in) der Film- und Medienwissenschaft
Sophie G. Einwächter über vorurteilsbehaftete Begrifflichkeiten und fruchtbare Momente in der Lehre
Was verstehen wir in der Film- und Medienwissenschaft eigentlich unter Forschungsdaten? Als ich 2018 zum BMBF-geförderten interdisziplinären Pilotprojekt FOKUS (Forschungsdatenkurse für Studierende und Graduierte)1 hinzustieß, war eine meiner ersten Aufgaben, Interviews mit Akteur_innen der Filmwissenschaft zu führen, um herauszufinden, mit welchen Daten sie in ihrem Studium oder ihrer Forschung operieren, und welche davon sie als die zentralen Forschungsdaten ihres Faches verstehen. Ziel des Projekts war, auf Grundlage der Erhebung bedarfsorientierte Kompetenzschulungen für Studierende durchzuführen, in denen sie Grundlagen des Forschungsdatenmanagements erlernen sollten.
In meinen Gesprächen mit Lehrenden und Promovierenden wurde bald deutlich, dass der Begriff der «Forschungsdaten» im film- und medienwissenschaftlichen Umfeld noch nicht etabliert ist, und ihm sehr unterschiedliche Zuschreibungen zuteilwerden. Während von Lehrenden Filme und Texte (im weitesten Sinne) als Forschungsdaten genannt wurden, also primär von den Forschungsgegenständen aus argumentiert wurde, wurden im Gespräch mit Promovierenden zuerst Daten genannt, die in Datenbanken und Archiven lagern, – Forschungsdaten also von ihrem Aufbewahrungsort her gedacht.2 In meinen Interviews sowie informelleren Gesprächen mit Kolleg_innen, aber auch innerhalb meiner Lehrveranstaltungen zum Thema, entwickelten sich lebhafte Diskussionen, was unter dem Begriff zu verstehen sei, und weshalb Forschungsdatenmanagement überhaupt in ein geisteswissenschaftliches Fach gehöre.
Teils waren die geäußerten Auffassungen von Ressentiments geprägt, insbesondere aufgrund der (als wissenschaftspolitisch empfundenen) möglichen Implikationen der involvierten Begriffe. «Forschungsdaten», das ist ein Begriff, den viele als einer naturwissenschaftlichen Logik folgend verstanden. Der Aspekt des Datenmanagements wiederum weckte Unbehagen gegenüber einer möglichen Unterwanderung der philologischen Fachtradition durch ein neoliberal motiviertes, auf Quantifizierbarkeit abgestelltes Effizienzdenken.
Oft herrschte zudem Unklarheit, ob unter Forschungsdaten Gegenstände oder Ergebnisse von Forschung zu verstehen seien.
Was sind überhaupt Forschungsdaten?
Definitionen von Forschungsdaten variieren. Das Wiki Forschungsdaten.org liefert einen Überblick und fasst unter Forschungsdaten «(digitale) Daten, die je nach Fachkontext Gegenstand eines Forschungsprozesses sind, während eines Forschungsprozesses entstehen oder sein Ergebnis sind».3
Auch die 2018 veröffentlichte Forschungsdatenmanagement-Policy der Goethe-Universität Frankfurt fasst den Begriff weit. Sie benennt Forschungsdaten «Grundlage und Ergebnis der wissenschaftlichen Arbeit. Sie sind die Grundlage des wissenschaftlichen Fortschritts und helfen bei der Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnis».
Die Zweckorientierung dieser Definition ist im Einklang mit dem Verständnis von Forschungsdaten, das der Forschungsdatenmanagement-Ausbildung der University of Edinburgh zugrunde liegt, welche bereits 2010 mit Research Data MANTRA, eine umfassende und sehr aufwändig gestaltete Open Educational Resource (OER) online bereit stellte. Der Kurs präsentiert sich als Mischform von Videos, textuellem Input, Fallbeispielen und interaktiven Abfragen von Wissen zur Selbstüberprüfung, und nutzt so gekonnt viele der von Maike Sarah Reinerth, Isabel Collien und Inga Nüthen besprochenen medialen Möglichkeiten einer OER. Hier werden Forschungsdaten zunächst als Informationstypus verstanden, der allerdings zu Analysezwecken gesammelt, beobachtet oder generiert werde, oder um Forschungsergebnisse zu validieren: «Unlike other types of information, research data are collected, observed or created, for the purposes of analysis to produce and validate original research results».
Hier wird deutlich: Forschungsdaten haben eine kontext- und zweckabhängige, situative Komponente, denn im Grunde kann alles zu Forschungsdaten werden, was unter einer wissenschaftlichen Fragestellung und zu analytischen Zwecken in den Blick genommen wird: «Research data can [...] be regarded as situational in that the same digital information or materials may be data for some research questions but not others. Likewise, the same information may be research data for a person at one time point, but not data at another time point, depending on whether that person uses that information or material for analysis». Die interdisziplinär ausgerichtete OER illustriert die situative Komponente von Forschungsdaten anhand eines Beispiels, das der Medienwissenschaft entstammen könnte: «CCTV footage may be archived (or destroyed) by a security firm. However, when used by a researcher to study human behaviour or 21st century surveillance methods, the video footage becomes data for that researcher».
Folgen wir einer der genannten weiten Definitionen von Forschungsdaten und behalten die situative Komponente dabei im Blick, ergeben sich für die Film- und Medienwissenschaft noch viel mehr mögliche Forschungsdaten als Filme oder Texte, nämlich sämtliches Material, das aus medienwissenschaftlicher Warte analytisch in den Blick genommen wird, ebenso wie Ergebnisse dieser Forschung, z.B. abstrahierende schematische Darstellungen wie etwa Sequenz- oder Einstellungsprotokolle, Listen von Timecodes, Screenshots, und natürlich Forschungsliteratur (letztere als Grundlage sowie auch als Ergebnis von Forschungsprozessen).
Weshalb Forschungsdatenmanagement?
Der MANTRA-Kurs der University of Edinburgh beinhaltet auch eine Reihe von Interviews mit Wissenschaftler_innen unterschiedlicher Disziplinen, die ihre Beweggründe für und Erlebnisse mit (gelungenem oder auch gescheitertem) Forschungsdatenmanagement darlegen. Hier etwa die Soziologin Lynn Jamieson:
EDINA and Data Library, University of Edinburgh. «MANTRA - Professor Lynn Jamieson. Importance of data management», Data Library /YouTube, University of Edinburgh.
Professionelles Arbeiten ist nur auf der Grundlage bestimmter Ordnungsprinzipien möglich. Jamieson spricht den Aspekt der sinnvollen Datenbenennung an, der darüber entscheiden kann, ob Forschende mit ihren Daten auch einige Zeit nach der Erhebung oder Aufnahme noch arbeiten können: «usability [...] can be quite profoundly undermined if you can’t find it or if you don’t know quite exactly what it was». Das Beherrschen von Techniken des Datenmanagements sei heutzutage als eine Art «basic literacy» zu begreifen – als eine Schlüsselkompetenz also, die genauso erlernt werden muss, wie das Lesen und Schreiben. Darüber hinaus gebe es aber auch eine Verantwortung der Öffentlichkeit gegenüber, Daten nach Möglichkeit in nachnutzbarer Form zu hinterlassen – insbesondere wenn die Forschung durch öffentliche Gelder gefördert wurde: «if you’re getting public funding to collect data, you have to leave data in a way that is usable for other people unless there [are] very good reasons not to do that.»4
Der Aspekt der Förderung von Wissenschaft spielt eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Techniken und Standards des Forschungsdatenmanagements. Zunehmend sind es Förderinstitutionen, die von Antragsteller_innen einfordern, sich vor Projektbeginn mit den unterschiedlichen Stadien zu befassen, die ihre Daten durchlaufen werden, und welche Notwendigkeiten technischer und organisatorischer Art damit einhergehen werden, gewissermaßen als Garant für ein Gelingen des antizipierten Projekts. «Bereits in die Planung eines Projekts sollten Überlegungen einfließen, ob und welche der aus einem Vorhaben resultierenden Forschungsdaten für andere Forschungskontexte relevant sein können und in welcher Weise diese Forschungsdaten anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt werden können», besagen etwa die DFG-Richtlinien für Forschungsdatenmanagement. Das Wiki Forschungsdaten.info listet Förderinstitutionen, die von Antragsteller_innen Forschungsdatenmanagement-Pläne einfordern. Forschungsdatenmanagementpläne orientieren sich oftmals am Modell des Forschungsdatenlebenszyklus’, der – je nach Modellierung in leichter Abwandlung – die folgenden Phasen durchläuft:
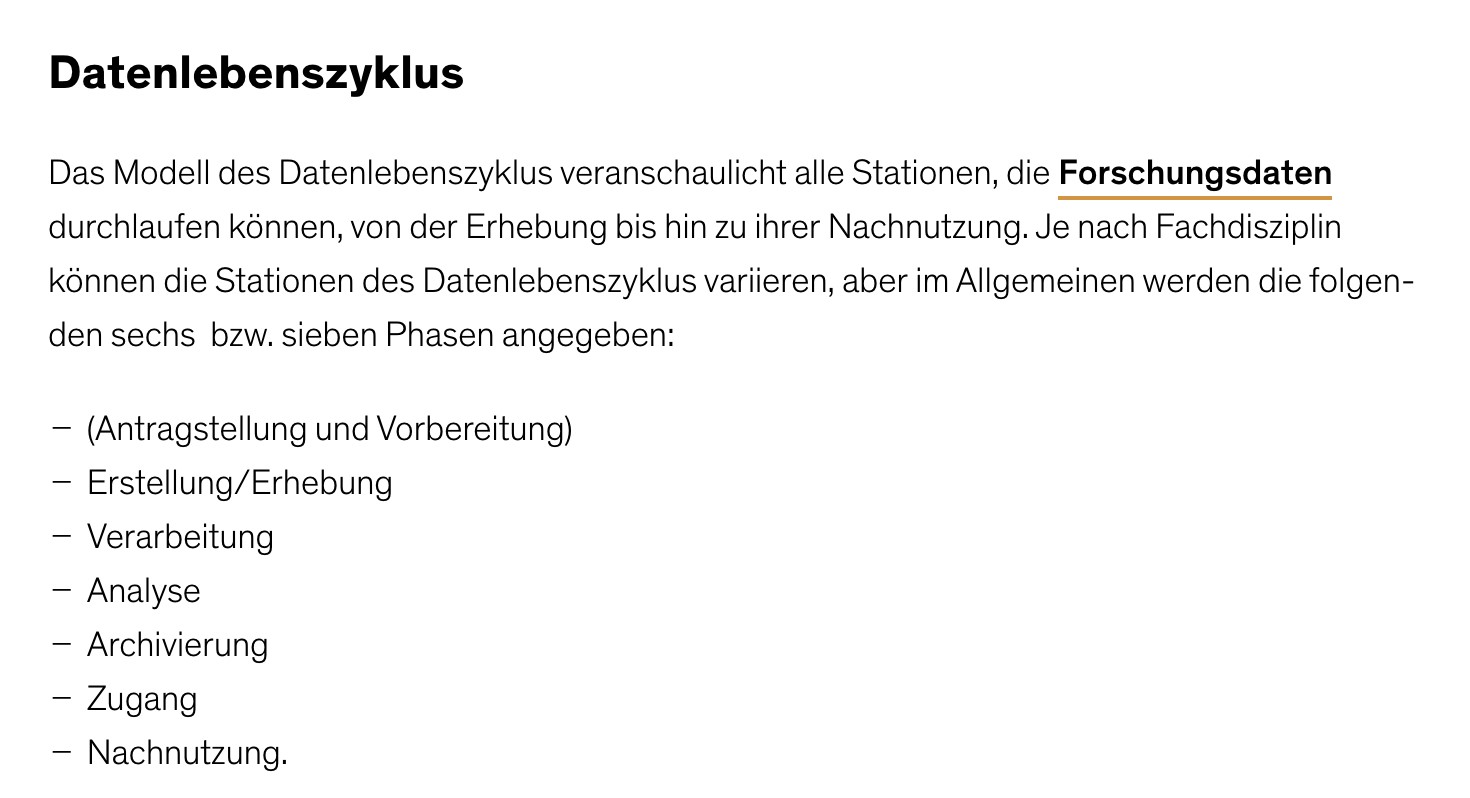
Abb. 1: https://www.forschungsdaten.info/support/glossar/#c273982
Nicht jeder Datenlebenszyklus ist auf Nachnutzung angelegt: es gibt Modellierungen, die mit der planmäßigen Löschung von Daten enden, was insbesondere im Kontext von personenbezogenen Daten, etwa innerhalb soziologischer Forschung, eine wichtige Rolle spielt (vgl.: Forschungsdatenmanagement Bayern. Forschungsdaten-Lebenszyklus).
In der Forschungsdatenmanagement-Policy der Goethe-Universität Frankfurt findet sich der Hinweis auf Datenmanagement als Aspekt der guten wissenschaftlichen Praxis: «Damit wissenschaftliches Arbeiten im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis möglich wird, müssen die Sicherung, Aufbewahrung, Pflege und nachhaltige Bereitstellung von Forschungsinformationen, -daten und -materialien nach anerkannten Standards erfolgen, hohen Anforderungen genügen und dabei die Fächerkulturen berücksichtigen.» Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis werden etwa von der DFG in ihren Empfehlungen festgehalten:

Abb. 2: Deutsche Forschungsgemeinschaft. Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis Denkschrift; Empfehlungen der Kommission «Selbstkontrolle in der Wissenschaft». Wiley-VCH, 2013, S. 21.
Es empfiehlt sich, über solche Richtlinien bereits im Studium zu informieren, um den Sinn eines strukturierten wissenschaftlichen Arbeitens begreiflich zu machen. Konfrontiert man Promovierende etwa mit der obigen Empfehlung, dass Forschungsdaten für den Zeitraum von zehn Jahren aufbewahrt werden sollen, wird vielen erstmals deutlich, dass eine solche Zielsetzung ganz konkrete Konsequenzen bereits für frühe Phasen des Umgangs mit Daten hat. Mehrere Studierende (BA und MA-Level) gaben nach meinen Lehrveranstaltungen und in der Evaluation an, dass die Beschäftigung mit und die Hinweise auf Forschungsdatenmanagement für sie zu einem günstigen Zeitpunkt kamen; bei den bereits Promovierenden gab es auch bedauernde Äußerungen, dass der Input nicht früher erfolgt sei, nun müssten fehleranfällige aber bereits etablierte Praktiken aufwändig nachgebessert werden.
Fruchtbare Momente in der Lehre
Für meine Studierenden war die Problemstellung, sich auf eine Speicherdauer von zehn Jahren einzustellen (mit dem Ziel, hinterher möglichst noch lesbare und verwertbare Daten vorzufinden) Anlass, pragmatische Dimensionen des Forschens im Hinblick auf technische Anforderungen und die Notwendigkeit bestimmter Ressourcen zu durchdenken. So machten sie sich in meinen Workshops Gedanken über:
- Zuverlässige Speicherungsorte und -strategien
- Speicherungsformate (Fragen nach geltenden Konventionen sowie Kompatibilität: welches Format wird möglichst systemübergreifend verwendet und verspricht längerfristig zu bestehen?)
- Generell: den Aspekt der Lebensdauer von Hard- und Software
- Nachvollziehbare Struktur und Benennung von Dateien und Ordnern
Solche Fragestellungen stellen sich nicht nur für Studierende, die beabsichtigen zu promovieren. Bereits in ihrer Alltagsgestaltung, in der mobile Endgeräte eine wichtige Rolle spielen, benötigen Studierende Kompetenzen des Umgangs mit hohem Datenaufkommen.
Im Studium profitieren Studierende besonders von Kenntnissen des Datenmanagements, vor allem der Literaturverwaltung.
Studierende und etablierte Wissenschaftler_innen bemerken gleichermaßen, dass Nachvollziehbarkeit von Ordnungssystemen insbesondere beim Arbeiten in Teams zu mehr Effizienz beim Arbeiten führt (bzw. umgekehrt, wie sehr Teamarbeit darunter leidet, wenn keine gemeinsamen Standards eingehalten werden). Es braucht also nicht immer den Verweis auf mögliche wertvolle Nachnutzung und wissenschaftlichen Fortschritt, um Sinnhaftigkeit von FDM zu vermitteln. Dass gelungenes Datenmanagement hilft, eine unerwünschte Arbeitsdopplung (etwa durch Datenverlust oder erschwerten Zugang) zu verhindern, wird Studierenden schon auf pragmatischer Ebene deutlich.
Eine zentrale Erkenntnis aus dem FOKUS-Projekt war, dass Kenntnisse über Forschungsdaten und ihr Management zu vermitteln, eine notwendige Reaktion auf Digitalisierungsprozesse in der Wissenschaft darstellt, und diese umzusetzen bereits im Studium Ziel sein sollte. Obwohl die Vermittlung dieser Inhalte sowohl von Lehrenden als auch Studierenden mehrheitlich begrüßt wurde, scheitert eine nachhaltige Durchsetzung in der Lehre aktuell oft noch an der konkreten Umsetzung: FDM-Veranstaltungen müssen in bestehende Curricula integriert werden, das heißt zunächst, dass Veranstaltungen und Kooperationspartner_innen gefunden werden müssen, an deren Inhalte «angedockt» werden kann. Das bedeutete im FOKUS-Projekt ganz konkret, dass Lehrende sich bereit erklären mussten, Sitzungstermine ihrer Veranstaltungen (etwa Kolloquien, Methodenkurse oder Einführungen ins wissenschaftliche Arbeiten) für unsere FDM-Inputs zur Verfügung zu stellen.
Denkanstöße für die Medienwissenschaft
Zum einen ist die Diskussion darüber, welche Daten eigentlich die zentralen Forschungsdaten der Medienwissenschaft sind, eine fruchtbare, die auch im Hinblick auf ein Selbstverständnis der Disziplin aufschlussreich ist. Erfahrungsgemäß wird sie mancherseits von der Angst begleitet, allein schon die Verwendung des Begriffs verrate die eigene Fachtradition.
Zweifelsohne sind andere Fächer der Film- und Medienwissenschaft in Fragen des Forschungsdatenmanagements, insbesondere der Nachnutzbarkeit von Daten weit voraus. Während es in der Biologie kein Novum darstellt, dass Wissenschaftler_innen anderen ihre Datenreihen zur Verfügung stellen – ergänzend zu oder auch anstelle von einer Artikelpublikation in einem Journal, lohnt es sich zu fragen:
- Wie könnte eine Datenpublikation bei uns aussehen?
- Wäre es denkbar, nicht nur kommentierte Arbeitsbibliografien5, sondern auch Sequenzprotokolle, Sammlungen von Screenshots oder relevanten Timecodes etc. zu veröffentlichen?
- Wo wäre der geeignete Ort dafür? Ist ein gemeinsames Repositorium, wie es mit dem media/rep kürzlich für film- und medienwissenschaftliche Forschungstexte eingerichtet wurde, auch für andere Forschungsdaten denkbar?
Eigen ist unserer Disziplin sicherlich die besondere Problematik der urheberrechtlichen Ansprüche, die mit fast allen unserer Forschungsgegenstände einhergehen, und das offene Teilen von vielen Materialien erschweren. Und auch bei den rechtlich weniger problematischen Beispielen (wie z.B. Sequenzprotokollen) stellt sich die Frage, was wir tun können (und wollen), um eine Nachnutzung von Forschungsdaten in der Medienwissenschaft in organisatorischer und institutioneller Hinsicht zu fördern und wissenschaftskulturell angemessen zu rahmen.
- 1Projekt FOKUS – Forschungsdatenkurse für Studierende und Graduierte, Beteiligte: Dr. Henrike Becker, (Goethe-Universität Frankfurt), Dr. Sophie Einwächter (Goethe-Universität Frankfurt), Benedikt Klein (Philipps-Universität Marburg), Dr. Esther Krähwinkel (Projektleitung, Philipps-Universität Marburg), Dr. Sebastian Mehl (Hochschule Fulda), Janine Müller (JLU Gießen), Frederik Ostsieker (Philipps-Universität Marburg), Julia Werthmüller (TU Darmstadt).
- 2Die Interviews waren qualitativ und zielten nicht auf Repräsentativität ab, aber vermittelten doch einen Einblick in die Schwerpunktsetzungen am jeweiligen Projektstandort. Dass Archivmaterial gerade am Institut der Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Goethe-Uni eine große Wichtigkeit für Studierende und Graduierte besitzt, erklärt sich durch die Schwerpunktsetzungen des Masterstudiengangs Filmkultur: Archivierung, Programmierung, Präsentation sowie des Graduiertenkollegs Konfigurationen des Films, die dort beheimatet sind.
- 3Diese Definition ist abgeleitet aus: Kindling, M.; Schirmbacher, P. (2013): «Die digitale Forschungswelt» als Gegenstand der Forschung. In: Information: Wissenschaft und Praxis 64 (2/3), S. 127–136.
- 4Handelt es sich bei Forschungsdaten etwa um personenbezogene oder sensible Daten, kann deren Bereitstellung zur Nachnutzung aus ethischen Gründen ausgeschlossen sein.
- 5Ich möchte vorschlagen, Formate wie etwa die Medienwissenschaft: Berichte und Papiere als geisteswissenschaftliche Datenpublikationen zu verstehen.
Bevorzugte Zitationsweise
Die Open-Access-Veröffentlichung erfolgt unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0 DE.
